

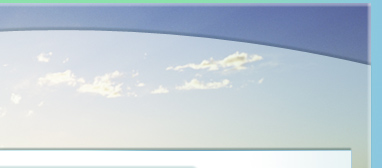



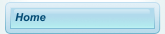 |
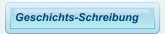 |
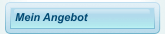 |
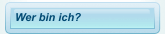 |
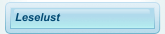 |
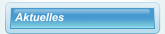 |
 |
 |
 |
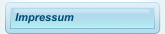 |


Auf den folgenden Seiten finden Sie Hinweise auf neue Publikationen und geplante Veranstaltungen. Wenn Sie Zeit und Lust haben, schauen Sie einfach mal rein!
__________________________________________________________________________________
Das Buch erscheint im August 2010 im Societäts-Verlag in Frankfurt am Main:
©Stephanie Zibell: GEMEUCHELT! Mörder und Gemordete in Rhein-Main.
„Gefährlich ist’s den Leu zu wecken,
Verderblich ist des Tigers Zahn,
Jedoch der schrecklichste der Schrecken,
Das ist der Mensch in seinem Wahn.“
(Friedrich Schiller (1759-1805): „Das Lied von der Glocke“)
Wie Recht Schiller mit dieser Feststellung hatte, erfuhren die Personen, von denen in den folgenden Kapiteln die Rede sein wird, am eigenen Leib. Vom Wahn getrieben fielen manche von ihnen über ihre arg- und ahnungslosen Mitmenschen her, um sie auf grausame und heimtückische Art und Weise zu töten. Andere wiederum begingen den Fehler, das Raubtier – den Leu – zu reizen, wofür sie mit ihrem Leben bezahlen mußten. Die einen waren demnach Täter, die anderen Opfer.
Sie alle verbindet, daß sie nach ihrem schrecklichen Tod oder ihrer fürchterlichen Tat kurzfristig ins Rampenlicht gerieten. Einen Augenblick lang standen sie und ihr Schicksal im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Doch so schnell wie ihr „Ruhm“ gekommen war, so schnell verging er auch wieder. Schon einige Zeit später erinnerte sich niemand mehr an sie, denn sowohl die Täter als auch die Opfer waren ganz gewöhnliche Menschen. Niemandem kam eine besondere gesellschaftliche Position zu, was zweifellos dazu beigetragen hätte, ihre Geschichte lebendig zu halten. Darüber hinaus waren die Taten zwar gräßlich, aber nicht in dem Maße spektakulär, daß sie in Werken, die sich mit spezifischen Täterpersönlichkeiten, Mordmotiven oder Tatdurchführungen beschäftigten, bemerkenswerten Niederschlag gefunden hätten. Mörder wie Karl Hopf oder Jacob Reul waren eben nicht vergleichbar mit Tätern wie Jürgen Bartsch (1946-1976) oder Fritz Haarmann (1879-1925).
Darüber hinaus gibt es aber noch ein weiteres Spezifikum, das jene Taten, Täter und Opfer, die in diesem Buch Erwähnung finden, verbindet: Sie alle lebten, starben oder mordeten zwischen 1844 und 1987 in der Rheingau-Taunus-Region, also in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Folglich müssen wir uns eingestehen, daß schreckliche Dinge nicht irgendwo auf der Welt geschehen, also weit weg von uns und unserem alltäglichen Leben, sondern direkt neben uns, und daß wir sowohl die Täter als auch die Opfer persönlich kennen (könnten). Wir müssen demnach auch hierzulande – vor der eigenen Haustür! – auf der Hut sein und die Augen offen halten! Vergessen Sie das nie! Und auch nicht, daß alle Geschichten, die ich Ihnen erzähle, wahr sind.
Aber: Das vorliegende Buch kann und will kein wissenschaftliches Werk sein. Vielmehr handelt es sich um eine Verknüpfung von historischen Fakten mit schriftstellerischer Freiheit. Das macht die Darstellung der Geschehnisse sowie die Motive für die Taten und die Persönlichkeit der Täter und Opfer etwas lesbarer und vielleicht auch verständlicher. Ganz besonders deutlich wird dies in dem Kapitel „Der Mordfall Hermann Schäfer“. Die hier auftretenden Figuren sind, mit Ausnahme des Opfers und derjenigen, die als „Personen der Zeitgeschichte“ gelten dürfen, wie zum Beispiel der Gauleiter Jakob Sprenger oder der Landespolizeipräsident Dr. Werner Best, erfunden. Gleiches gilt für die Darstellung des Sachverhalts in Form von Aktennotizen, Vermerken über Zeugenaussagen, Tagebucheinträge und so weiter. Die Inhalte und Formulierungen, die der Leser dort vorfindet, stammen allesamt von mir und haben in erster Linie die Aufgabe, den relativ verzwickten Tatbestand aufzudröseln und darüber hinaus die unterschiedlichen Interessen und Sichtweisen in Bezug auf den Fall nachvollziehbar darzustellen.
„Der Mordfall Hermann Schäfer“ beschäftigt sich übrigens mit einem Geschehen, das sich im Sommer 1933 in Frankfurt am Main zutrug. Auf der „Isenburger Schneisenbrücke“ begegnete der abtrünnige Nationalsozialist Hermann Schäfer seinem Mörder. Der Förster Heinrich Orlopp aus dem Rheingauer Weindorf Hallgarten wiederum traf den seinen im Jahr 1916 mitten im Wald. Ahnungslos lief er dort dem Übeltäter vor die Flinte. Ebenso arglos wie der Förster war auch Jette Weyershäuser, als ihr Mörder im Sommer 1844 plötzlich und unerwartet über sie herfiel und sie grausam ums Leben brachte. Wie im Fall Karl Hopf handelte es sich bei dem Verbrechen an der in Soden, dem heutigen Bad Soden, lebenden Magd um eine Beziehungstat. Doch anders als bei dem an Jette Weyershäuser begangenen Mord waren die Untaten, die der frühere Varieté-Künstler Hopf beging, von langer Hand geplant. Die Giftmorde, die ihn im Jahr 1914 den Kopf kosten sollten, beging er in Wörsdorf bei Idstein, Niederhöchstadt und Frankfurt am Main. In der zuletzt genannten Stadt schlug im Herbst 1925 auch die Krankenschwester Wilhelmine Flessa zu. Wie Jette Weyershäuser und Karl Hopf kannte sie ihr Opfer gut, denn es handelte sich dabei um ihren Geliebten, den Arzt Dr. Seitz. Während der von der Krankenschwester erschossene Mediziner aber wenigstens kurz nach der Tat und hochoffiziell zur letzten Ruhe gebettet werden konnte, wie es sich gehörte, brachte der 1987 in Wiesbaden brutal ermordete Michael Körppen einige Tage in einen Teppich gewickelt zu, während die Täter versuchten, ihm in der Nähe des Tatorts ein heimliches Grab zu schaufeln.
Sie sehen, wir leben gefährlich. Das gilt für heute ebenso wie für längst vergangene Tage. Ergo: Die angeblich gute alte Zeit, die hat es nie gegeben! Schufte und Strolche lauerten schon immer auf ihre arg- und wehrlosen Opfer. Sie hock(t)en hinter Bäumen und Sträuchern, aber manchmal teilten – und teilen – Täter und Opfer auch Tisch und Bett. Wir müssen also in jedem Falle vorsichtig sein!
In diesem Sinne – alles Gute und stetige Sicherheit
wünscht Ihnen
Stephanie Zibell













